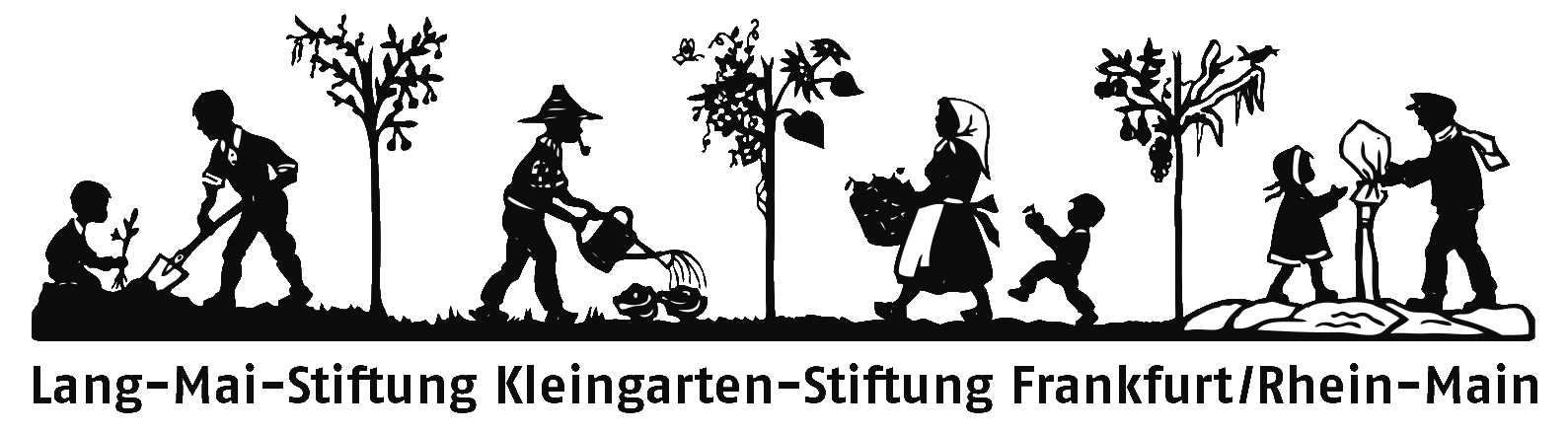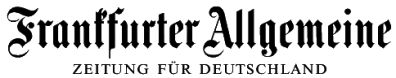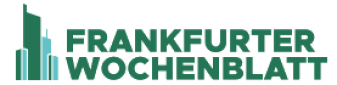Aktuelle Berichterstattungen
Anspruchsgrundlage für Frankfurt am Main als "Green City" !
Ganz besonderer Naturschutz
Lang-Mai-Stiftung
ins Goldene Buch eingetragen
Altstadt – Ein Goldenes Buch hat jede Stadt. Ein Goldenes Buch der Stiftungen nur Frank
furt. Mit derzeit mehr als 600 Stiftungen ist die Mainmetropole auf diesem Gebiet einzig-
artig in Deutschland.
Einzigartig in Deutschland ist auch die Lang-Mai-Stiftung Kleingartenstiftung Frankfurt/ Rhein-Main. Die Gartenliebhaber und engagierten Naturfreunde Oliver Lang und Birgit Mai errichteten ihre gemeinnützige Stiftung am 19. Januar 2017. Nun konnte die Gründung feierlich ins Goldene Buch der Stiftungen eingetragen werden. Dazu fanden sich rund 80 Gäste im Limpurgsaal des Römer ein. Saxofonistin Martina Porzelt stimmte mit „Sunny“ musikalisch auf die Veranstaltung ein.
Stadtrat Mikael Horstmann hielt die Festrede. Er hatte eine Mini-Gartenschere dabei, Beleg für sein Engagement im gepachteten Grabeland. „Im Limpurgsaal steckt viel Demokratie, da tagten von 1867 bis 1919 die Stadtverordnetenversammlungen“, erinnerte Horstmann an die Geschichte.
Das Engagement von Lang und Mai hingegen sei ein Bespiel für gelebte Demokratie außerhalb des Parlaments. Es gehe ihnen nicht nur um Erhalt und Entwicklung von Kleingärten, sie übten auch Kritik an Hindernissen und Bürokratie.
„Verteilungskämpfe um Flächen bleiben nicht aus, manchmal steht man vor Dilemmata. Die Politik muss jederzeit ein offenes Ohr haben, darf niemanden bevorzugen oder benachteiligen“, sagte der Stadtradt. Die Stifter bräuchten Geduld, Hartnäckigkeit und einen langen Atem – gerade das zeichne Oliver Lang und Birgit Mai seit vielen Jahren aus.
Das nächste Lied, „What a wonderful World“, ist eine Momentaufnahme und Utopie gleichermaßen. Anschließend erläuterten Lang und Mai im Dialog Sinn und Zweck ihrer Stiftung. Mit ihr „soll das Kleingartenwesen in der Stadt Frankfurt am Main und der Region weiterhin zukunftsorientiert weiterentwickelt und der Bestand der Kleingarten-flächen dauerhaft geschützt und weiter ausgebaut werden.“
Lang und Mai geht es um Grün, Frischluft, Biodiversität. „Kleingärten sind seit 125 Jahren Bildungsträger. Aber es hat sich viel verändert, Unkraut wird nicht mehr mit Stumpf und Stiel ausgerottet, sondern heute genussvoll verzehrt“, äußerte Lang und bemerkte: „Wir sind die wahren Grünen, kämpfen als Nature Soldiers. Und dagegen, dass sich die Fläche der Kleingärten aufgrund von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen und Politikgerangel verringert.
„Wir können eine Kleingartensiedlung innerhalb eines Jahres entwickeln, das ist uns in Würzburg und Wiesbaden gelungen“, berichtete Oliver Lang. In Frankfurt stand die Stiftung bereits Kleingartenvereinen inHeddernheim, Kriftel und am Buchhang sowie den Gemüseheldinnen bei. Aktuell setzen sich die Engagierten für ein Bildungscafé Bornheim ein.
„Die Stiftung ist noch recht jung, aber die Saat ist aufgegangen“, beschloss Lang.
Dann trugen sich Oliver Lang und Birgit Mai ins Goldene Buch der Stiftungen (zweiter Band) ein, Mikael Horstmann bestätigte den Eintrag mit seiner Unterschrift.
Kehrt nun Ruhe ein? Das ist nicht zu erwarten. Die beiden werden weiter für ihre Anliegen streiten – dafür sind sie bekannt, dafür werden sie geschätzt. jf
05.02.2025 © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH Alle Rechte vorbehalten.
Ehrung für Gartenstiftung
Eintrag ins Goldene Stiftungsbuch
Das „Goldene Buch der Stiftungen" ist erstmals seit drei Jahren wieder um eine Stiftung erweitert worden. Die Lang-Mai-Stiftung Kleingarten-Stiftung Frankfurt/Rhein-Main erhielt am Montagabend im historischen Limpurgsaal des Frankfurter Römer feierlich ihren Eintrag.
2017 gründeten Oliver Lang, Stiftungsvorsitzender, und seine Lebensgefährtin Birgit Mai, stellvertretende Vorsitzende, die Kleingarten-Stiftung.
Die beiden Naturfreunde setzen sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung von Kleingartenflächen in Frankfurt und der Region ein. Außerdem unterstützen sie Vereine dabei, ihre Flächen vor Fremdbebauung zu schützen und für die Gemeinschaft zu erhalten. Mit der Aufnahme in das „Goldene Buch der Stiftungen" will das Paar ein Zeichen für die Bedeutung des urbanen Kleingartenwesens setzen, wie Lang sagte.
Das Frankfurter „Goldene Buch der Stiftungen" ist einzigartig in Deutschland.
Der erste Band geht auf die Dreißigerjahre zurück und umfasst Einträge von 108 Frankfurter Stiftungen. Seit 2012 wird ein zweiter Band geführt, in dem nun seit Montagabend 23 Stiftungen verzeichnet sind.
Der Eintrag der Lang-Mai-Stiftung thematisiert den Stiftungszweck und ist passend zum Thema Natur gestaltet: Ein Baum ziert den rechten Rand der Seite und trägt an seinem Stamm ein Gemälde der beiden Stiftungsgründer. Zeichnungen von Gartenarbeitern ziehen sich entlang der Kopfzeile.
Gemeinsam mit Stadtrat Mikael Horstmann (Volt) unterzeichneten Lang und Mai den Eintrag in das goldene Buch und hinterließen damit einen „Fußabdruck in der Frankfurter Geschichte", wie Lang sagte.
Mit dem Festakt sei jedoch erst der Grundstein für das Stiftungsvorhaben gelegt: „Der Boden ist bereitet, die Saat ist aufgegangen, und nun gilt es zu düngen und das Wachstum zu fördern." fras.
Ehre für Gärtnerin
Stadt zeichnet Birgit Mai aus
Bornheim.
Mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ist Birgit Mai ausgezeichnet worden. Bürgermeister Uwe Becker (CDU) überrreichte der Schriftführerin des Kleingartenvereins Buchhang am Bornheimer Hang die Auszeichnung für besonderes ehernamtliches Engagement.
Neben ihrem Posten im Vorstand, den sie seit 2000 inne hat, innitiierte und gestaltete Mai den "Senioren- und Gemeinschaftsgarten" im Verein. Das Pilotprojekt wurde mit dem Frankfurter Nachbarschaftspreis 2004 ausgezeichnet. Mit weiteren Kleingärtnern rief sie den Dachverband R.V. Kleingärtner Frankfurt / Rhein-Main ins Leben und gründete die Kleingarten Stiftung, die das Kleingartenwesen in Frankfurt und in der Region fördert und unterstützt. Becker lobte Mai in seiner Laudatio als "Anwältin der Kleingärtner".
Einer, der handelt
Oliver Lang erhält Bürgermedaille der Stadt
– Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler beginnt seine Rede mit einem Zitat von Dante Alighieri: „’Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. ’So einer ist Oliver Lang.“
Siegler und Lang duzen sich, sie kennen einander aus gemeinsamen Zeiten auf der Helmholtzschule. Nun also erhält Oliver Lang die seit 2002 vergebene Bürgermedaille, die bis zu fünf Mal pro Jahr verliehen werden kann – in diesem Jahr ist es die dritte. Mit ihr wird einer geehrt, der einen herausgehobenen Beitrag für das Gemeinwohl im Ehrenamt geleistet und Verantwortung übernommen hat. „Solche Menschen machen Frankfurt ein Stück liebenswerter“, unterstreicht Siegler. Oliver Lang arbeite in verschiedenen Ehrenämtern tatkräftig, verlässlich und diszipliniert. Schon Anfang der 1980er Jahre trainierte er eine Basketballmannschaft von Eintracht Frankfurt und war auch als Schiedsrichter tätig. In den 1990er Jahren übernahm er als Schöffe am Jugendgericht Verantwortung. Seit 1992 gehört Lang dem Prüfungsausschuss der IHK Frankfurt an und ist inzwischen Vorsitzender des Gremiums.
Viel Herzblut steckt der Engagierte in die Kleingärtnerei. Den vor 88 Jahren gegründeten Verein Buchhang, dem er seit über 20 Jahren angehört, führt er seit vielen Jahren als Erster Vorsitzender. „Er hat dem Verein ein Gesicht gegeben“, würdigt Siegler. Dabei hat so ein Vorsitzender einiges zu tun; er muss Versammlungen organisieren, Gelder beschaffen, klug verhandeln, Streitigkeiten schlichten. Gerade der KGV Buchhang hat ein nicht immer einfaches Umfeld in der Nähe von Dippemess, Eissporthalle und FSV-Platz. Diskussionen um Kleingärten und Wohnungsbau kommen hinzu.
Die "guten Gene" des Vaters
Vor einigen Jahren gründete Oliver Lang mit anderen Aktiven den Regionalverband Kleingärtner und ist dessen Vorsitzender, seit 2015 gibt es im Nordend zwischen Dortelweiler Straße und Günthersburgpark den vom Regionalverband initiierten Kleingartenweg. Lang engagiert sich darüber hinaus für das historische Rosengärtchen am Röderberghang. „Für uns beide sind damit Kindheitserinnerungen verbunden“, bemerkt Siegler. Der Aktive habe bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, die Bürgermedaille sei nun das Sahnehäubchen. Der Geehrte bedankt sich besonders bei seinem anwesenden Vater, von dem er wohl die „guten Gene“ habe, außerdem bei seiner Lebenspartnerin Birgit Mai für viele gute Ideen und dafür, dass sie ihm den Rücken freihalte.
„Kleingärten sind Gegenwart und Zukunft“, sagt Lang. So ein Garten sei Ort der Begegnung und der Selbstfindung, Ort des Lernens und der Gesundheit. Sie böten Geborgenheit und Gemeinschaft gleichermaßen und hätten heute eine wichtige Ausgleichsfunktion in einer immer dichter bebauten Stadt. „Wir müssen zur Entwicklung von Stadtkonzepten miteinander reden“, unterstreicht Lang. Die Bürgermedaille sei ihm nicht nur Ehre, sondern auch Ansporn.
 Oliver Lang, hier hinter seinem Wohnhaus in Bornheim. kämpft für den Erhalt der Kleingärten in Wohnungsnähe. Foto: Christoph Boeckheler
Oliver Lang, hier hinter seinem Wohnhaus in Bornheim. kämpft für den Erhalt der Kleingärten in Wohnungsnähe. Foto: Christoph Boeckheler
Kleingärten
„Irgendwo muss das Grün bleiben“
Oliver Lang über Oasen in der Stadt, den Kampf um Flächen und die Zukunft der Kleingärten
Herr Lang, wie beobachten Sie als Kleingärtner die Diskussion über mögliche neue Flächen für Wohnungen in Frankfurt?
Mit gemischten Gefühlen. Es besteht die Gefahr, dass Kleingartenfläche verloren geht und Ersatz an anderer, nicht gut geeigneter Stelle entsteht.
Wie konkret sind Ihre Befürchtungen?
Aktuell bedroht sind Kleingärten etwa im sogenannten Innovationsquartier, am Rebstockgelände und beispielsweise auch in Dreieich. Dort könnten Kleingärten verschwinden, wenn es so kommt, wie es sich
die Architekten vorstellen. Fast in Vergessenheit geraten ist der Kleingartenverein Kleeacker in Fechenheim. Dort soll eine Verbindungsstraße gebaut werden. Aber es kann nicht sein, dass dafür
Kleingartengelände geopfert wird.
Gewerbeflächen werden umgewandelt, Äcker bebaut. Ist es angesichts des großen Wohnungsmangels nicht verständlich, dass auch die Bebauung von Kleingärten
kein Tabu ist?
Die Begehrlichkeiten sind teilweise nachvollziehbar. Man muss aber auch die Bedürfnisse der Bevölkerung ernst nehmen.
Was hat die Allgemeinheit davon, wenn Sie Gemüse ziehen oder sich in die Sonne legen?
Das mit dem In-der-Sonne-Liegen ist jetzt etwas provokativ gefragt. Der Kleingarten ist für mich ein Ort der Begegnung, von Lebensfreude und Schönheit, der aber auch etwa der preiswerten
Versorgung mit Obst und Gemüse dient. Er ist ein Lernort für Gesundheit, Ernährung und Umweltbewusstsein. Wir als Kleingärtner tragen auch zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Diese finden Sie
inzwischen eher in der Stadt, weil es draußen, auf dem platten Land, nur noch Monokultur gibt. Wenn man jetzt die grünen Inseln, die Oasen in den Städten zubetoniert, verschwindet auch das.
Was ist so schlimm, wenn für einen geschützten Kleingarten an anderer Stelle Ersatzflächen entstehen?
Erstmal ist gut, dass für Kleingärten nach dem Bundeskleingartengesetz Ausgleich geschaffen werden muss. Wenn aber an einem Ort Kleingärten wegfallen und woanders ein Ausgleichsareal entsteht, bleibt
die Fläche vielleicht gleich groß. Doch was haben die bisherigen Nutzer davon, wenn sie eine Stunde quer durch Frankfurt fahren müssen, um in den Garten zu kommen?
Der Architekt Karl Richter geht davon aus, dass die Stadt seine Pläne für eine Parkstadt am Rebstock wegen des erwarteten Widerstands der Kleingärtner
ablehnt. Sie gelten offenbar als mächtige Lobbyisten.
So wird es gerne dargestellt. Wir vertreten unsere Interessen, treten ein für die Kleingärtnerei, letztlich auch für Landschaftsschutz, Landschaftspflege und Naturschutz. Es gibt sicherlich größere
Lobbygruppen als die der Kleingärtner. Aber man sollte uns nicht unterschätzen. Wir werden um jedes Gelände kämpfen. Die Stadt Frankfurt nennt sich Green City. Irgendwo muss das Grün bleiben.
An der Wolfsheide in Preungesheim wehrten sich Kleingärtner so erfolgreich, dass die damalige Koalition ihre Planungen für ein neues Wohngebiet
einstellte.
Das war ein Erfolg. Leicht ist es aber nicht: Man muss gut argumentieren können und gut vernetzt sein.
Bereiten Sie sich mit anderen Kleingärtnern darauf vor, stärker für Ihre Rechte kämpfen zu müssen, weil die Begehrlichkeiten noch
wachsen?
Ja. Fläche lässt sich ja nicht vervielfachen. Wenn weiterer Wohnungsbau gewünscht ist, woher die Fläche nehmen? Da bleiben fast nur landwirtschaftliche Fläche und Grüngürtel. Man sollte sich einmal
fragen, ob die Bevölkerungsprognosen überhaupt Bestand haben. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt ins Rentenalter hinein. Vielleicht sollte man lieber Altenwohnanlagen bauen als neue Wohnungen
im hochpreisigen Segment.
Noch geht die Politik davon aus, dass Frankfurt weiter wächst und man deshalb bauen muss. Wo sollen denn neue Wohnungen entstehen, wenn man das Grün
schützen will?
Die Stadt könnte durchaus einen Teil der Freizeitgärten, die ihr oder stadtnahen Stiftung gehören, bebauen lassen und dafür an anderer Stelle Kompensation betreiben. Die Stadt muss beim Bau neuer
Wohnungen zudem gemeinsam mit dem Umland vorgehen.
Nicht nur der Wohnungsbau bedroht die Kleingärtner. Auch der Ausbau der Verkehrsnetze könnte Flächen kosten.
Mit Sicherheit. Aber für uns macht es keinen Unterschied, ob die Flächen für Wohnungsbau oder den Verkehr benötigt werden. Kleingärten müssen in der Nähe der Bevölkerung bleiben.
Werden die Kleingärtner auch etwas anders machen müssen, sich vielleicht stärker öffnen?
Teilweise ja. Zum Beispiel bietet mein Kleingärtnerverein Buchhang Veranstaltungen, bei denen die Öffentlichkeit und die Nachbarn einbezogen sind. Der Verein läuft auf dem Bornheimer Kerbezug mit und
verteilen Gartenerzeugnisse und Samentütchen, damit er im Stadtteil präsent ist.
Was erhoffen Sie sich von dem Kleingarten-Entwicklungskonzept, an dem das Umweltdezernat arbeitet?
Frischen Wind für das Kleingartenwesen, ein Aufbrechen alter Strukturen. Die öffentliche Zugänglichkeit wird ein Thema sein, aber auch etwa die Gestaltung der Gärten. Da ist einiges zu überdenken.
Ändern sollte sich auch etwas beim Umgang mit Grünschnitt. Bisher müssen Kleingärtner für dessen Anlieferung bezahlen.
Wird es nicht auch um die Flächenfrage gehen?
Doch. Wir wollen manifestiert haben, dass Kleingärten nicht nur in Randlagen existieren, sondern dort, wo die Wohnungen entstehen, damit es kurze Wege gibt. Es reicht uns nicht, den Bestand zu
schützen. Wir wollen, dass beispielsweise am Riedberg ein neues Kleingartengelände entwickelt wird. Der Arbeitstitel ist Klimagärten. Vielleicht kann man dort neue Ideen miteinbeziehen, eventuell
einen Lehrpfad anlegen.